Wort-und Wissen-Info 4/2024
Inhalt
- Grußwort von Boris Schmidtgall
- Evolutionsdidaktik ohne offene Fragen
- Neuerscheinung: Arbeitsheft zu „Schöpfung oder Evolution“
- Rezension: DVD „Macht Leid Sinn?“ – ein erstklassiger Gesprächseinstieg
- Dreißig Jahre Arbeitsgruppe für biblische Archäologie (ABA)
- W+W-Kalender 2025 und neuer Fotowettbewerb
- Stellenausschreibung Sachbearbeiter
- Dank des Schatzmeisters
- Studium Integrale Journal
- Fachtagungen
Grußwort von Boris Schmidtgall
Liebe Freunde von Wort und Wissen,
die Wissenschaftskultur, wie sie sich in der westlichen Welt entwickelt hat, ist unbezweifelbar ein großer Segen. Darin dürften sich alle einig sein – unabhängig davon, welche Weltsicht man vertritt. Auch wenn einige diesen Zusammenhang bestreiten – die Wissenschaft haben wir hauptsächlich der jahrhundertelangen Prägung durch den christlichen Glauben zu verdanken. Es ist demnach ein naheliegender Gedanke, dass die schwindende gesellschaftliche Relevanz des christlichen Glaubens zu Erosionserscheinungen in der Wissenschaft führt. Auch wenn die Beweisführung hinsichtlich dieses Zusammenhangs nicht ganz einfach ist – um den unerfreulichen Trend mancher Wissenschaftsgebiete aufzuzeigen, bedarf es keiner aufwändigen Recherche. Um nur einige Schlaglichter zu nennen:
1. Schon länger ist die Rede von einer „Reproduzierbarkeitskrise“. Das bedeutet, dass in Fachartikeln veröffentlichtes, neu erworbenes Wissen sich bei wiederholter Prüfung als unzuverlässig erweist. Davon zeugen inzwischen viele Artikel, u. a. „Is there a reproducibility crisis?“ (M. Baker, Nature 2016).
2. Auch Fälschungen und allgemeine Korruption der Wissenschaft werden vermehrt beklagt, zum Beispiel in dem lesenswerten Aufsatz „Innere und äußere Korruption der Wissenschaft“ (K. Morawetz, in dem Buch „Die verlorene Wissenschaft. Versuch einer Katharsis nach Corona“, 2023).
3. Manche greifen sogar zu einer recht drastischen Wortwahl und sprechen bereits vom „Tod der Wissenschaft“ (P. R. Goodard & A. G. Dalgleish, „The death of science“, 2022). In der Analyse und Diagnose gibt es breite Übereinstimmung, nicht jedoch hinsichtlich der Benennung der Ursachen.
Die Wissenschaftskultur braucht eine gründliche Umkehr
Einige sprechen vom stark gestiegenen Publikationsdruck, dem Prinzip „publish or perish“ (veröffentliche oder stirb). Dies hängt zusammen mit einem sich immer weiter verschärfenden Wettkampf um Fördergelder inklusive wachsender Bürokratie. MORAWETZ bringt diesen Sachverhalt gut auf den Punkt: „Es geht damit nicht mehr vorrangig um die Suche nach Wahrheit und die Vermittlung und Weitergabe von Wissen und Bildung, sondern um das Einwerben möglichst vieler Gelder.“ Er bringt in seinem Aufsatz auch das „Verschwinden kritischen Denkens“ und die „Infantilisierung der Wissenschaft“ zur Sprache – Dinge die anscheinend Hand in Hand gehen. Darüber hinaus thematisieren alle Kritiker den wachsenden Einfluss der Politik auf die Wissenschaft, der sich in der Vorgabe von
Forschungsthemen und -Projekten äußert. Das alles trifft im Wesentlichen zu, doch wird nicht nach tieferen Ursachen geforscht, z. B. woher die „Infantilisierung der Wissenschaft“ rührt. Die bloße Feststellung eines Werteverfalls in Kombination mit dem Aufruf, zu dem Humboldt’schen Bildungsideal zurückzukehren (Morawetz) wird wohl kaum zu einer nachhaltigen Trendumkehr führen. Die Heilige Schrift verspricht Besserung nur bei gründlicher Umkehr – zu dem Geber von Weisheit, Vernunft und Wissenschaft, dem Schöpfer des Himmels und der Erde.
Herzlich, Ihr Boris Schmidtgall
Evolutionsdidaktik ohne offene Fragen
Besprechung von Reinhard Junker zum neuen Lehrbuch „Didaktik der Evolutionsbiologie“
Sven Gemballa & Ullrich Kattmann (Hrsg., 2024) Didaktik der Evolutionsbiologie. Zwischen Fachkonzepten und Alltagsvorstellungen vermitteln. Berlin: Springer Spektrum. 566 Seiten, 44,99 €.
Die Autoren dieses umfangreichen Sammelbandes behandeln Fragen der Vermittlung evolutionsbiologischer Inhalte in 31 Einzelbeiträgen. Nach einer Einführung (Teil I) geht es im Teil II in neun Beiträgen um „Evolution als naturwissenschaftliches Erklärungsmodell und seine Vermittlung“.
Es folgen in Teil III acht Beiträge über die Vermittlung der naturhistorischen Perspektive von Evolution. Teil IV widmet sich „nichtwissenschaftlichen Ansichten“, zu denen die Autoren – nicht überraschend – neben Eugenik und Rassenlehre auch Kreationismus und Intelligent Design rechnen (vier Beiträge). In den Teilen V und VI wird die Vermittlung des Themas „Evolution“ in verschiedenen Schulstufen und an verschiedenen Lernorten behandelt (Zoo, Botanischer Garten, Museen, Lerngänge; insgesamt neun Beiträge).
In dieser Buchbesprechung soll streiflichtartig nur auf einige Punkte eingegangen werden, die aus der Sicht der Arbeit von Wort und Wissen von besonderem Interesse sind. Angesichts der Tatsache, dass in den letzten Jahren von Befürwortern der Evolutionslehre (!) vermehrt thematisiert wurde, dass der (neo-)darwinistische Mechanismus durch Mutation, Selektion und Gendrift evolutionäre Innovationen nicht erklärt und dass daher nach neuen Lösungen gesucht wird,1 erlebt man bei der Lektüre dieses Buches einen regelrechten Flashback. Die zentrale Stellung der Selektionstheorie sei unstrittig (S. 6). Aus der Selektionstheorie leite sich logisch die Existenz von Evolution ab (S. 6 und 7f.). Selektion scheint alles zu können.2 Wie kann das sein, wo Selektion allenfalls das survival des fittesten erklären kann, aber nichts zu dessen arrival sagen kann? Die Verwendung der Begriffe „Evolution“ und „Evolutionstheorie“ ist oft unklar. Empirisch nachvollziehbare Beispiele, die Erwähnung finden, handeln von Anpassungsvorgängen (Mikroevolution), die nichts über Innovationen (Makroevolution) besagen.
Der Schluss auf die Ermöglichung evolutionärer Neuheiten (Makroevolution) wird nicht problematisiert (z. B. S. 142). Entsprechend werden Erklärungsprobleme von Evolutionstheorien nicht thematisiert oder sie werden (zu Unrecht) als gelöst hingestellt (z. B. S. 313f.). Die Erkenntnisse darüber, dass Behauptungen über vermeintliche Fehlkonstruktionen wie der Aufbau des Linsenauges (S. 457f.) auf Unkenntnis und fehlerhafter Argumentation beruhen, sind an den Autoren offenbar vorbeigegangen. Von aktuellen Befunden über deren ausgeprägte Funktionalität findet sich bei ihnen keine Spur. Auch die kontroverse Diskussion über den Status der Evolutionsbiologie als historischer Theorie, die Evolution nicht aus Gesetzmäßigkeiten und Randbedingungen ableiten kann,3 findet kaum Erwähnung. Vielmehr wird „die Evolutionstheorie“ (unklar, was gemeint ist) unsachgemäß auf eine Stufe mit physikalischen Theorien gestellt (S. V).
Ein durchgängiges didaktisches Motiv ist die Anknüpfung an „Alltagsvorstellungen“ über Evolution und allgemeine „lebensweltliche Denkfiguren“ und deren Korrektur.4 Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich sinnvoll, aber dazu gehört nach Ansicht der Autoren auch und vor allem das konsequente Austreiben teleologischer Vorstellungen aus den Köpfen der Schüler, also die Vorstellungen von Zielgerichtetheit, die auf einen Schöpfer verweisen. Die Vorstellungen von Anpassungen auf einen Zweck hin seien eine „Lernhürde“ (so z. B. S. 52, 91).
Außerdem es wird festgestellt, dass die Überwindung dieses durch den Alltag geprägten Denkens schwierig sei (s. z. B. Kapitel 3 und 5). Das ist kein Wunder, denn es widerspricht jeder Erfahrung, dass ohne Plan und Steuerung komplex-funktionale Dinge entstehen.
Evolutionsbiologie soll nach den Vorstellungen der Autoren schon ab dem Grundschulalter unterrichtet werden (Kapitel 23) und Evolution könne auch ohne Kenntnis von Genetik unterrichtet werden (S. 99). Hier ist kritisch anzumerken, dass ohne Kenntnis und Verständnis der Faktoren, die Evolution vorantreiben, eine Evolution nur als nette Geschichte vermittelt werden kann. Mit Wissenschaft hat das nichts zu tun, sondern eher mit Indoktrination von Lerninhalten, die den Alltagserfahrungen der Kinder diametral widersprechen.
Von besonderem Interesse für einen W+W-Mitarbeiter ist Kapitel 19 über Kreationismus und Intelligent Design. Schon die Verwendung des „Leugner“-Begriffes ist in diesem Zusammenhang tendenziös. An den Ausführungen von Dittmar Graf über dieses Thema ist erkennbar, dass dieser Autor nur wenig Kenntnisse über diese beiden Ansätze hat, dafür umso mehr Vorurteile. Das mittlerweile im deutschsprachigen Raum vorliegende Schrifttum findet keinen Widerhall.
Wie soll man sich sonst Sätze erklären wie „Kreationismus beruht auf der fehlenden Unterscheidung von Glauben und Naturwissenschaft“? Oder es würde aus dem Fehlen einer lückenlosen Rekonstruktion der Entstehung komplexer Strukturen geschlossen, dass diese „nicht rekonstruierbar“ seien? Oder dass nur auf der Basis von Nichtwissen für einen Schöpfer argumentiert werde.
Diese Fehlerliste könnte fortgesetzt werden. Es ist frustrierend, diese Ignoranz feststellen zu müssen, und es zeigt sich, dass keinerlei Interesse vorhanden ist, sich sachorientiert einer kritischen Diskussion und den tatsächlich vorgebrachten Argumenten zu stellen. Stattdessen müssten die Lehrkräfte darauf achten, dass die Schüler nicht durch den Kreationismus verunsichert werden, so der Autor (S. 325).
Fazit: Wenn es nach den Autoren dieses Sammelbandes geht, lernen die Schüler, dass es keinerlei grundsätzliche Erklärungsprobleme in Evolutionstheorien gibt, dass mit Selektion alles erklärt werden kann, dass Kritiker „Leugner“ sind und keine wirklichen Argumente haben und dass Glaubensinhalte und wissenschaftlich begründete Erkenntnisse zwei nicht überlappenden Bereichen zugehören (S. 324, 343). Sie lernen nicht die wichtigen Unterscheidungen von Variation und Innovation, von experimenteller und historischer Forschung – und sie lernen nicht, was Befürworter der biblischen Schöpfungslehre oder des allgemeiner gehaltenen „Intelligent Design“ tatsächlich vertreten und wie sie ihre Sicht der Dinge begründen. Wenn das Buch eines zeigt, dann dass die Arbeit der Studiengemeinschaft Wort und Wissen dringend nötig ist und dass es wichtig ist, dass einzelne Christen und christliche Gemeinden sich dieses Themas annehmen.
Literatur und Verweise
- Vgl.: Junker R (2024) Rezension von „Evolution ‚on purpose‘“ in Stud. Integr. J., Ausg. 2, S. 143.
- „Für die Entstehung komplexer Merkmale wie etwa des Auges als Sinnesorgan kennt die Evolutionstheorie keinen anderen Prozess als natürliche Selektion“ (S. 85).
- Dies wird ausführlich diskutiert in: Junker R & Widenmeyer M (Hrsg., 2021) Gibt es eine naturwissenschaftliche Evolutionstheorie? In: Schöpfung ohne Schöpfer? Studium Integrale. Holzgerlingen, S. 35-64.
- Schon in der Einleitung wird festgestellt, „dass viele Alltagsvorstellungen von Lernenden im Widerspruch zu den fachlich angemessenen Konzepten stehen“ (S. V).
Neuerscheinung: Arbeitsheft zu „Schöpfung oder Evolution“
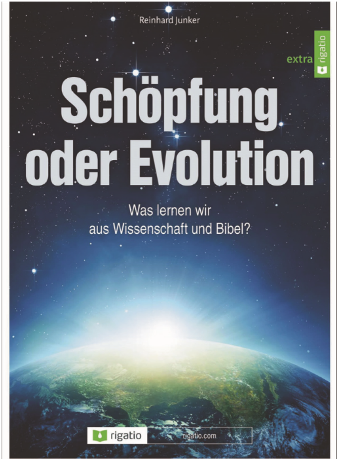
Dieses Heft ist wirklich schön zu lesen. Der Autor bringt schöne und sehr interessante Beispiele, an denen man „eigentlich sehen muss, dass es eine Schöpfung gab.“ (Kommentar eines Schülers)
Schöpfung oder Evolution. Was lernen wir aus Wissenschaft und Bibel?
Ein Arbeitsheft von Reinhard Junker für Hauskreise, Jugendgruppen und evangelistische Treffen
66 Seiten, geheftet, Format 17 x 24 cm, mit Farbabbildungen. Rigatio Stiftung, 5,95 € (A: 6,10) / SFr. 8,00
„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde …“ (1. Mose 1,1) – war es wirklich so – oder hat die Wissenschaft Gott als Schöpfer längst abgeschafft? Das Thema „Schöpfung und Evolution“ ist ein heiß diskutierter Dauerbrenner – aus gutem Grund, denn es geht um nicht weniger als um die Fragen unserer Herkunft und unserer Identität. Die Frage, ob es einen Schöpfer gibt, betrifft jeden, auch wenn viele Zeitgenossen diesbezüglich gedankenlos ihr Dasein fristen mögen. Ob wir geplant, gewollt und sogar geliebt sind, macht einen großen Unterschied zu einem atheistisch geprägten Selbstverständnis, wonach wir zufälliges Ergebnis bloßer Naturprozesse sind.
Dieses Arbeitsheft von Reinhard Junker behandelt Argumente zu der Frage, ob die Fakten aus der Biologie eher für zufällige Entstehung (Evolution) oder für geplante Erschaffung (Schöpfung) sprechen. Wie kann man das anhand naturwissenschaftlicher Daten und Ergebnisse prüfen? Was sind Schöpfungsindizien, wie kann man diese finden und begründen, dass sie wirklich klar auf einen Schöpfer hinweisen?
Und kann man auf der Basis von Schöpfung überhaupt Wissenschaft betreiben? Schließlich wird genau das vielfach vehement bestritten (vgl. die Buchbesprechung zu „Didaktik der Evolutionsbiologie“ in dieser Info-Ausgabe). Um solche Fragen geht es in diesem Arbeitsheft. Mit Fragen, die an Alltagserfahrungen anknüpfen, kann jeder Jugendgruppen- oder Hauskreisleiter leicht die Thematik für die Gruppe erschließen. Oder man arbeitet das Heft für sich persönlich durch. In einem biblischen Teil geht es auch um die Frage, ob Evolution als Schöpfungsvorgang interpretiert werden kann. Auch in diesem Teil werden die wesentlichen Aspekte anhand von Fragen erarbeitet, die helfen, ins Gespräch zu kommen.
Inhalt
- Zwei Arten von Quellen für die Erforschung der Ursprünge: Wissenschaft und Bibel
- Schöpfungsindizien – Ist Gott in der Schöpfung erkennbar?
- Weitere Hinweise auf die Weisheit eines Schöpfers in der Natur
- Evolution als Vorgang der Schöpfung? Welche Folgen hat „Theistische Evolution“ für den christlichen Glauben?
Rezension: DVD „Macht Leid Sinn?“ – ein erstklassiger Gesprächseinstieg
Dokumentarfilm (DVD): 55 Min. Preis: 12,00 €, VIMEO: Download: 7,99 €; Leihgebühr: 3,99 €, Sprachen: Deutsch und Englisch
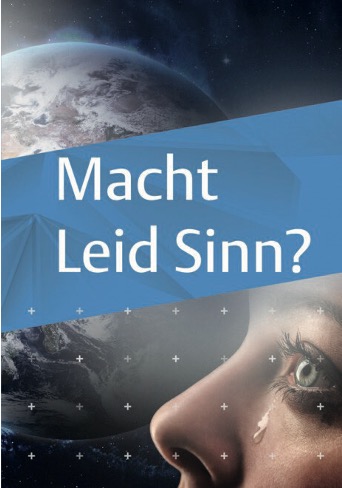 „Macht Leid Sinn?“ – so heißt ein neuer Dokumentarfilm des Instituts für Glaube und Wissenschaft (IGUW), der mittlerweile auf DVD und im Portal VIMEO zum Streaming und Download erhältlich ist. Zahlreiche Wissenschaftler und Experten sowie Betroffene von schwerwiegenden Leiderfahrungen kommen darin zu Wort. Sie beantworten verschiedene Fragen zum Thema Leid, die sich vielen Menschen irgendwann einmal stellen. Der Zuschauer wird in die Perspektive eines Internet-Users ersetzt, der seine Fragen zum Thema Leid per Suchmaschine eintippt und dann Videointerviews mit Experten anklickt.
„Macht Leid Sinn?“ – so heißt ein neuer Dokumentarfilm des Instituts für Glaube und Wissenschaft (IGUW), der mittlerweile auf DVD und im Portal VIMEO zum Streaming und Download erhältlich ist. Zahlreiche Wissenschaftler und Experten sowie Betroffene von schwerwiegenden Leiderfahrungen kommen darin zu Wort. Sie beantworten verschiedene Fragen zum Thema Leid, die sich vielen Menschen irgendwann einmal stellen. Der Zuschauer wird in die Perspektive eines Internet-Users ersetzt, der seine Fragen zum Thema Leid per Suchmaschine eintippt und dann Videointerviews mit Experten anklickt.
Wirklich außergewöhnlich, ja geradezu einzigartig, ist die Breite an internationalen und deutschen Experten, die zu diesem Thema interviewt werden. Dazu gehören: ein islamischer Philosoph, ein jüdischer Rabbi, ein atheistischer Philosoph, ein christlicher Theologe (Prof. Dr. Matthias Clausen) und viele mehr. Auch chronische Schmerzpatienten, eine Genozid-Überlebende und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen wie z. B. Prof. Dr. Peter Imming (Pharmazie), der Althistoriker Dr. Jürgen Spieß und der berühmte Mathematikprofessor Prof. Dr. John Lennox kommen zu Wort. Sie alle beantworten die Frage, welche Rolle Leid in ihrer Weltanschauung spielt und welche Antworten diese für Sinnsuchende bereithält. „Wir müssen beide Probleme [Leiden durch menschliches Verhalten und durch Naturkatastrophen] anpacken und uns die Frage stellen, wie diese Dinge Sinn ergeben können. Und sie zu verstehen, hängt von der Weltanschauung ab. Wir schauen uns das Universum an und sehen die Schönheit der Andromeda-Galaxie, die Schönheit einer Blume oder eine Bergszenerie; andererseits … sehen wir Tsunamis, … Tornados … und Krebs. Jede Weltanschauung, die diesen Namen verdient, muss sich diesem ambivalenten Bild stellen“ (Prof. Dr. John Lennox).
Hier nur ein paar Impressionen, was solche Antworten sein können:
In den fernöstlichen Religionen führt der Umgang mit Leid in die Meditation, um nicht nur dem Leiden, sondern der mit ihm untrennbar verbundenen Realität unseres Lebens komplett zu entfliehen (Leben = Leiden). Das für wichtige fernöstliche Religionen zentrale Prinzip Karma bedeutet hierbei, „dass du in gewisser Weise verdienst, was dir zustößt“ (Dr. Sharon Dirckx, Neurowissenschaftlerin). Insbesondere für Reinkarnationsvorstellungen zeigt sich damit die Einsamkeit leidender Menschen, wenn sie Hilfe von anderen Menschen wünschen: „… wenn jemand das Leiden von Armut und Krankheit und Betteln [durch Reinkarnationen] erleben muss, und du dieser Person hilfst, und ihre Situation änderst, muss sie dieses Leben noch einmal leben“ (Elis Potter, ehemaliger Buddhistischer Mönch, Theologe).
Wie beim Judentum und Christentum steht auch im Islam der Mensch einem Schöpfergott gegenüber, der durch die Leiden in eine leidlose, glückliche Ewigkeit begleiten kann. Dem Islam zufolge ist Leiden dabei vor allem eine vorherbestimmte Prüfung Gottes, die zum Menschsein einfach dazu gehört.
Und wie ist es im Atheismus bzw. Säkularismus? „Judentum, Christentum und natürlich auch andere [Religionen] haben diese Vorstellung von einer ewigen Realität jenseits der gegenwärtigen Welt. Aber für säkulare Menschen ergibt sich ein Problem, weil sie keine absolute Realität haben, auf die sie blicken können. Sie haben das, was vor ihnen liegt. Und sie glauben, dass das alles ist, was es gibt … Und worauf beziehen sie sich, wenn es Leid gibt? Das ist eine sehr schwierige Frage“ (Esmé Partridge, Interfaith Consultant).
Der Religionskritiker und atheistische Philosoph Dr. Dr. Joachim Kahl wird besonders deutlich, wenn er indirekt aufzeigt, dass der Atheismus im tiefsten Grunde keine Antwort bzw. Hoffnung auf die Leidfrage anbieten kann: „Das Trösten mit religiösen Gesichtspunkten [ist] aus meiner Sicht ein Vertrösten …, weil es substanzlos ist. Und man muss sozusagen auch einräumen, dass es trostlose, rettungslose Situationen gibt, wo ein Trost nicht möglich ist – ehrlicherweise. Da hilft auch nur produktive Resignation in dem Sinne, dass man […] praktisch hilft. Aber man muss praktisch sagen, da sind die Grenzen menschlicher Solidarität erreicht. Deshalb auch immer mein Hinweis auf die Entwicklung der Tierwelt: Dass die von Anfang von List und Tücke und Gewalt lebt …“ Da er aus dem Atheismus und dem damit eng verbundenen Darwinismus (Kampf ums Überleben) heraus selbst keine tragfähigen Antworten zum Umgang mit Leid geben kann, verweist Joachim Kahl dann darauf, dass auch der Glaube an einen Schöpfergott große Probleme mit sich bringen würde. Kahl verwendet hierzu das altbekannte Theodizee-Problem (die Frage nach der Gerechtigkeit/Rechtfertigung Gottes): „Wenn Gott zugleich allmächtig und allgütig sein soll, woher kommen dann die Leiden? Entweder er ist nicht allmächtig und kann sie nicht verhindern oder abschaffen. Oder er ist nicht allgütig und will sie nicht abschaffen. Beides ist sozusagen einer Gottheit unwürdig …“
Der islamische Philosoph Dr. Shabbir Akhtar wiederum meint zur Theodizee Frage: „Ich glaube, es gibt Grenzen für das, was man sagen kann – außer sich einfach darauf zu berufen, dass es ein Geheimnis ist … Meiner Meinung nach kann dieses Problem angesprochen werden; ich denke nicht, dass es durch einen der Theismen [monotheistische Religionen] gelöst werden kann, obwohl ich auch glaube, dass das Christentum im Vergleich mehr Ressourcen zur Beantwortung dieses Problems hat als der Islam und das Judentum.“ Und der christliche Althistoriker Dr. Jürgen Spieß weist darauf hin, dass man die Theodizee-Frage auch umdrehen kann: „Wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Und schon im 5. Jahrhundert hat jemand die Gegenfrage gestellt: Wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es so viel Schönheit in der Welt?“ Soweit ein paar Impressionen und Zitate.
Anschließend wird im Film die christliche Sicht entfaltet, dass Gott ja ein Gott ist, der sich in Jesus Christus selbst dem Leiden dieser Welt am Kreuz gestellt hat. Er ist ein Gott, der gerade im Leiden bei uns ist und uns helfen kann, trotz Leiden eine Hoffnung zu behalten. Auch an vielen weiteren Beispielen wird die Frage, wie man Leiden mit oder ohne christlichem Glauben begegnet, diskutiert. In Anbetracht des komplexen Themas, das eine der schwierigsten Fragen der Menschheit überhaupt behandelt, werden dabei ein paar Denkmöglichkeiten und Hinweise auch zum Umgang mit Leidenden aus unterschiedlichen Perspektiven angesprochen. Einen gewichtigen Kritikpunkt gibt es allerdings: Der Film behandelt das Thema Leid aus biblischer Perspektive nicht vollumfänglich. Der Zuschauer erfährt zum Beispiel nicht wirklich den eigentlichen Grund für Jesu Leiden, wie ihn der Apostel Petrus entfaltet – nämlich, dass Jesus dort die Schuld jedes einzelnen Menschen stellvertretend trug: „Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte“ (1. Petrusbrief 3,18; Schlachter Übersetzung); und wie es Jesus Christus selbst beim Abendmahl vorhergesagt hat: „Denn dies ist mein Blut, das des [neuen] Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden“ (Matthäus 26,28; Elberfelder Übersetzung CSV). Die Schwere der Sünde, die verantwortliche Rolle des Menschen im Sündenfall für den Rest der Schöpfung sowie biologische und medizinische Implikationen, und auch die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes (welche neben Gottes Allmacht und Güte entscheidende Charaktereigenschaften bezüglich der Theodizee-Frage sind) uvm. kommen an diesem Punkt zu kurz. Hier gäbe es aus theologischer Sicht noch so viel zu sagen – so viel mehr, als in einer Dokumentation mit 55 Minuten Laufzeit unterkommen könnte. Hier würde man aber wohl von einem so interdisziplinären und interreligiösen Werk – und genau da liegt ja die Stärke und Einzigartigkeit dieses Films – zu viel erwarten. Der Film ist daher ein Gesprächs- und Diskussionseinstieg, aber keine vollumfängliche Abhandlung des Themas.
Was die DVD definitiv leisten kann, und wozu sie auch wärmstens empfohlen werden kann – unabhängig davon, ob in Hauskreisen oder evangelistischen Bibelkreisen, – ist, dass sie einen äußerst spannenden und tiefgründigen Gesprächsstoff bietet. Dabei ist sie interessant, alltagsrelevant, emotional berührend und technisch auf hohem Niveau umgesetzt. Die angerissenen Themen und Fragestellungen sollten dann aber gemeinsam mit der Bibel in der Hand vertieft und besprochen werden. Auch ersetzt der Film keine biblische Seelsorge für Leidende.
Von der Thematik her wäre die DVD an sich auch gut für das Gespräch mit jungen Menschen geeignet, allerdings ist themengemäß die explizite bildliche Darstellung von Gewalt, Krieg und Leiden nicht für jede Altersklasse geeignet – hier empfiehlt es sich, den Film zuvor Probe zu schauen.
Benjamin Scholl
Links:
- https://www.iguw.de/veroeffentlichungen/dvds/
- https://www.wort-und-wissen.org/produkt/macht-leid-sinn/
Dreißig Jahre Arbeitsgruppe für biblische Archäologie (ABA)
Am 4.–6. Oktober 2024 fand unsere diesjährige Archäologie-Tagung zum Thema Inschriften aus biblischer Zeit statt. Die Tagung, an der etwa 90 Präsenzgäste und 30 Zoom-Gäste teilnahmen, war zugleich unser 30-jähriges Jubiläum. Tatsächlich fand die erste Archäologie-Tagung von Wort und Wissen (damals noch als „Fachtagung für Archäologie und Geschichte“) vor 30 Jahren mit etwa 30 Teilnehmern im Seminarhaus der Studiengemeinschaft in Röt im Schwarzwald statt. Als Hauptreferent hatten wir damals den Ägyptologen David Rohl eingeladen, mit dem ich bereits seit mehr als zehn Jahren zusammengearbeitet hatte.
Schon bei der ersten Tagung lag der Fokus deutlich auf chronologischen Fragen aus der biblischen Archäologie. Kein Wunder – denn chronologische Fragen begeisterten mich bereits seit meiner Jugendzeit und ich hatte schon enge Kontakte zu Kollegen in England, als ich 19 Jahre alt war (mit der Society for Interdisciplinary Studies, wozu auch mein späterer Doktorvater John Bimson und Peter

Abb.1: Besucher Ruthild Eicker und ihr Mann Michael Grothe mit Peter van der Veen vor dem Rollup der Arbeitsgruppe ABA während der diesjährigen Tagung im Schönblick (Bild M. Grothe).
James und David Rohl gehörten). Auf der ersten Tagung im Sommer 1994 durfte ich auch Uwe Zerbst kennen lernen, der damals einen Vortrag zu radiometrischer Datierung hielt. Uwe und ich haben seitdem zusammen die Tagung geleitet. Wir haben auch gemeinsam mehrere Bücher und Artikel veröffentlicht, die inhaltlich dieser Arbeit entstammen. 2002 erschien der erste Sammelband Biblische Archäologie am Scheideweg? Für und Wider einer Neudatierung archäologischer Epochen im alttestamentlichen Palästina. Darin haben wir versucht, die von David Rohl favorisierte Chronologie im Licht neuerer Forschung kritisch auszuwerten. Dieses gemeinsame Projekt sollte die Richtung unserer Archäologie-Arbeit für die nächsten Jahre prägen. Denn obwohl wir heute immer noch der Meinung sind, dass die archäologische Chronologie des zweiten vorchristlichen Jahrtausends einer Revision bedarf, stellte sich doch heraus, dass Rohls Ansatz zu radikal war. Mithilfe unserer Arbeit (und der Zusammenarbeit mit vielen Kollegen u. a. aus England, Amerika und Israel) sollte ein internationales Forum entstehen (die sog. BICANE-Gruppe = Bronze to Iron Age Chronology of the Ancient Near East), in der Grundsatzfragen zur Zuverlässigkeit der Datierung alter vorderasiatischer Kulturen ausgewogen geprüft werden inzwischen arbeiten wir an der Fertigstellung des zweiten Tagungsbandes, der voraussichtlich 2025 erscheint).
Nun sollte die Chronologie nicht die einzige Fragestellung bleiben, womit wir uns beschäftigen würden. Geprägt von meiner eigenen Forschung im Bereich der Datierung von beschrifteten Siegeln aus Israel und Jordanien (dem Thema meiner Doktorarbeit für die Uni Bristol, Abschluss 2005) und Habilitationsarbeit (Universität Mainz, Abschluss 2018), haben wir uns wiederholt mit Inschriften aus der Levante beschäftigt, die für die Erforschung der biblischen Welt wichtig sind. Nachdem wir 1997 unseren Tagungsstandort nach Tübingen (Albrecht-Bengel-Haus) verlegt hatten, kamen neue Kollegen zur Arbeit dazu, wie z. B. Professor Martin Heide, der sich in der folgenden Zeit (u. a.) mit beschrifteten Scherben aus dem eisenzeitlichen Israel beschäftigte. Auch der bekannte evangelikale Altorientalist Professor Alan Millard hat wiederholt bei uns Vorträge gehalten und uns auch bei der pigraphischen Arbeit beraten. Da der Wechsel nach Tübingen unsere Erwartung, in einer Universitätsstadt die Nähe zu Studenten zu haben, nicht erfüllte, entschlossen wir uns 2005 nach Schwäbisch Gmünd (Christliches Gästezentrum Württemberg, Schönblick) zu wechseln.
Der größte Durchbruch gelang dort ab 2007, da seitdem jährlich über 100 Gäste (Studenten, Lehrer, Fachleute und interessierte Laien) teilnahmen. Auch waren wir seitdem in der Lage, international renommierte Fachleute einzuladen, wodurch unsere Arbeit bekannter wurde. Inzwischen hat die Studiengemeinschaft etwa sechs Studenten aus archäologisch verwandten Fachbereichen finanziell während ihres Doktoratsstudiums unterstützt. Ich selbst hatte bereits zwischen 1999 und 2002 ein Stipendium für meine Doktorarbeit bekommen, bis ich dann im April 2002 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Studiengemeinschaft angestellt wurde. Zudem betreuen wir als Arbeitsgruppe seit vielen Jahren zwei archäologische Dauerausstellungen, im Schönblick (mit dem Ausstellungskatalog „Von Ur bis Nazareth“) und im Bibelmuseum Wuppertal („Zuhause und in der Fremde“) zu den Reisestationen der Erzväter. Auch haben wir an Grabungen in Israel teilgenommen (z. B. in Ramat Rahel) und eine Vorgrabung in Ost-Jerusalem angefangen, wo wir nach Überresten aus der Zeit Salomos und der späteren Königszeit suchen. Eine Teilnehmerin hat bei der diesjährigen Tagung zurecht betont: Gott hat unsere Arbeit über so viele Jahre ganz besonders gesegnet. Viele Menschen durften im Glauben gestärkt und neue Entdeckungen durften gemacht werden. Eine neue Generation wächst nun innerhalb der Arbeit heran und wir sind sehr dankbar dafür, dass diese jungen Menschen tatkräftig mithelfen, die Tagung durchzuführen und auch im Bereich der biblisch-archäologischen Forschung im Rahmen ihrer Doktorarbeiten tätig sind.
Wir blicken mit Zuversicht auf die Zukunft und sind gespannt, was Gott noch mit uns vorhat.
Peter van der Veen
W+W-Kalender 2025 und neuer Fotowettbewerb
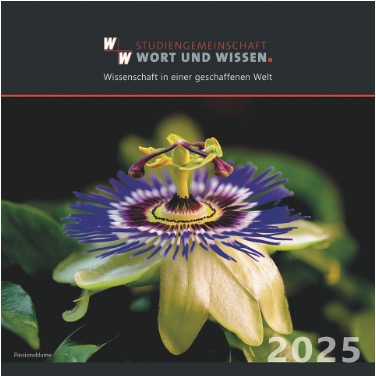 Der neue W+W-Kalender für das Jahr 2025 ist verfügbar und gibt neue Einblicke in Gottes wunderbare Schöpfung. Die zwölf hochwertigen Fotoaufnahmen aus dem Freundeskreis der Studiengemeinschaft zeigen dabei unterschiedliche Facetten der Schöpfungsforschung. Für die aktive Mitarbeit und die vielen Einsendungen aller Teilnehmer möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Auch im nächsten Jahr wird es wieder einen Fotowettbewerb für den neuen Kalender 2026 geben. Wir freuen uns auf vielseitige Aufnahmen, die die unterschiedlichen Arbeitsbereiche von W+W beleuchten: Archäologie/Geschichte, Biologie, Geowissenschaften, Kultur und Geschichte, Philosophie, Physik/Kosmologie und Wirtschaft.
Der neue W+W-Kalender für das Jahr 2025 ist verfügbar und gibt neue Einblicke in Gottes wunderbare Schöpfung. Die zwölf hochwertigen Fotoaufnahmen aus dem Freundeskreis der Studiengemeinschaft zeigen dabei unterschiedliche Facetten der Schöpfungsforschung. Für die aktive Mitarbeit und die vielen Einsendungen aller Teilnehmer möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Auch im nächsten Jahr wird es wieder einen Fotowettbewerb für den neuen Kalender 2026 geben. Wir freuen uns auf vielseitige Aufnahmen, die die unterschiedlichen Arbeitsbereiche von W+W beleuchten: Archäologie/Geschichte, Biologie, Geowissenschaften, Kultur und Geschichte, Philosophie, Physik/Kosmologie und Wirtschaft.
Zur Teilnahme am Wettbewerb 2026 schicken Sie Ihre Fotos bitte mit vollständiger Angabe Ihrer Postanschrift an die folgende E-Mail-Adresse: fotowettbewerb@wort-und-wissen.de. Pro Teilnehmer können maximal drei Bilder eingeschickt werden. Die Voraussetzungen sind, dass Sie selbst Urheber und somit Fotograf der Fotos sind und dass die Bilder im Querformat aufgenommen wurden. Bitte vermerken Sie des Weiteren in der E-Mail, was auf den jeweiligen Fotos dargestellt ist, z. B. Name, Bezeichnung oder Ortsangaben. Der Teilnahmeschluss ist der 1. Mai 2025; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Jury wählt aus allen Einsendungen die Bilder für den neuen Kalender aus. Neben ästhetischen und qualitativen Kriterien spielen auch die Originalität sowie die Verknüpfung zu den W+W-Fachbereichen eine zentrale Rolle. Sollte Ihr Foto für den kommenden Kalender ausgewählt werden, erhalten Sie drei Kalender kostenlos und für jedes im Kalender verwendete Foto einen Gutschein über 20 € für frei wählbare Artikel aus dem Online-Shop von W+W. Im Vorfeld bedanken wir uns für Ihre Teilnahme und freuen uns auf Ihre Bildbeiträge.
„Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Ihr Völker, bringet dar dem HERRN, bringet dar dem HERRN Ehre und Macht!“ Psalm 96,6–7
Stellenausschreibung Sachbearbeiter
Sachbearbeiter/-in (Teilzeit) ab 1. 2. 2025
Ihre Aufgaben:
- Übernahme der Buchhaltung
- Annahme von Bestellungen und Versand
- Mitarbeit/Organisation und Koordination von Veranstaltungen
Ihr Profil:
- Kenntnisse in der Buchführung (OPTIGEM-Kenntnisse von Vorteil)
- Bereitschaft im Team zu arbeiten
- selbständige und strukturierte Bearbeitung übertragener Aufgaben
- kommunikative Fähigkeiten in Wort und Schrift (MS Word)
Unser Angebot:
- Unbefristete Stelle (Teilzeit), Stundenzahl verhandelbar
- Gut ausgestattetes Büro
- Ein engagiertes, kreatives Team in einem christlichen Werk
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte an:
Prof. Dr. Henrik Ullrich
Studiengemeinschaft Wort und Wissen e.V.
Peter-Stein-Straße 4
72250 Freudenstadt
henrik.ullrich@wort-und-wissen.de
Dank des Schatzmeisters
„Denn euer Dienst und eure Opfergabe füllen nicht nur die leeren Hände der Heiligen, sondern werden weiterwirken als vielfältiger Dank an Gott.“
2. Kor 9,12
Paulus spricht hier zwei Dinge an, die auch in der Studiengemeinschaft wichtig sind: Dienst und Gabe. Rückblickend auf 2024 staune ich wieder über die vielen Hände, die zu ganz unterschiedlichen Diensten gebraucht wurden: z. B. Schreiben von Fachartikeln, Organisieren von Tagungen, Verteilen von Einladungszetteln oder die einfach zum Gebet gefaltet wurden. Ich sehe aber auch die vielen finanziellen Gaben, die uns die ganze Arbeit ermöglicht haben. Ich öffne die Kontobücher (in ihrer Elektronischen Version) und staune darüber, wer alles immer wieder aufs Neue das Werk der Studiengemeinschaft mit Spenden bedacht hat. Von den geplanten 648.000 € Einnahmen sind Ende Oktober schon 472.000 € (73%) eingegangen (von den geplanten Ausgaben in Höhe von 687.000 € wurden allerdings auch schon 526.000 € ausgegeben). Somit beträgt das Defizit aktuell 50.000 €. Auch wenn die Personalkosten durch ausgeschiedenen Mitarbeiter etwas gesunken sind, freuen wir uns über realisierte Buchprojekte, viele Vorträge, gut besuchte Fachtagungen und die Neueinstellung von Christopher Scholl. Er soll künftig u. a. als Grafiker und Youtuber die Geschäftsstelle mit seinen Gaben stärken. Spenden haben aber auch eine doppelte Wirkung: sie füllen die „leeren Hände“ der Studiengemeinschaft und führen anderseits dazu, dass Gottes Gerechtigkeit auf Erden zunimmt und die Dankbarkeit
ihm gegenüber überströmt. Gott wird von denen gepriesen, die die Gaben empfangen und von denen, die den Segen der Dienste der vielen, auch ehrenamtlichen Mitarbeiter, erfahren. Ich möchte Sie daher ermutigen, am besten beides zu tun, mitzuhelfen wo es geht, und zu geben.
Für die anstehenden Weihnachstage wünsche ich Ihnen und Ihren Familien die Erfahrung von Gottes Segen.
Ihr Stephan Schmitz
Studium Integrale Journal
Das evolutionskritische Magazin
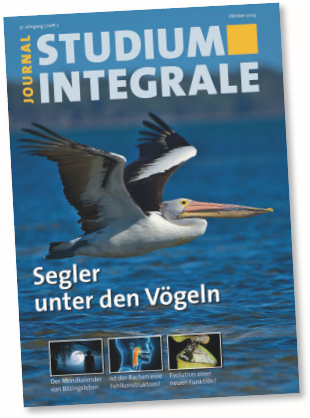 Themen Heft 2 / 2024
Themen Heft 2 / 2024
- M. Brandt & B. Scholl: Der Mondkalender des Homo erectus von Bilzingsleben. Frühmensch war
geistig hochstehend - N. Crompton & R. Junker: Schmetterlinge und Mendel’sche Artbildung Vielfalt durch Variationsprogramme bei den „Jezebels“
- B. Schmidtgall: Reparaturmechanismen in der Zelle. 2. Proteine – die „rostende“ Maschinerie des
Lebens - L. Sáenz: Die Illusion des Alters. Die Rolle sumerischakkadischer Übersetzungen in der alttestamentlichen Forschung
- R. Junker: Ameisen-Chirurgen. Ameisen retten Artgenossen das Leben mit Antibiotika und Amputation
- K. Bauer: Ist der menschliche Rachen eine Fehlkonstruktion?
- H.-U. Katzenmaier: Die Fingerabdrücke: Gottes Identifikationsplan. Erkenntnisse aus der Hautleistenforschung
- M. Brandt: Intelligenter Frühmensch. Homo erectus mit ausgeklügelter Steinwerkzeugpräparationstechnik
- B. Scholl: Die Störartigen. Ein Missgeschick enthüllte einen „uralten“ Grundtyp
- P. Borger: Transposons: Konzipiert, um rasche Anpassungen der DNA zu bewirken?
Streiflichter: Segler unter den Vögeln mit spezieller Anatomie • Kannenpflanze: Evolution einer neuen Funktion? • Ein Pilz wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde • Explosive Fruchtwände beim Schaumkraut • Der Evolution auf die Sprünge helfen • Wie die DNA ständig entknotet wird • Frühmensch Homo heidelbergensis mit hochentwickelter Holzbearbeitungstechnik • Oktokorallen: Plötzliches Auftauchen der Biolumineszenz im Kambrium? • Der Mechanismus von Antikythera belegt kulturelle Degeneration • Junger Ozean unter der Oberfläche des Saturnmondes Mimas
Jahresabo (2 Ausgaben; je 56–64 S.): 15,– € (außerhalb D: 17,–) / SFr. 23,– (Studenten/Schüler: 10,– €; außerh. D: 12,– / SFr. 15,–); Einzelheft: 8,50 €; älteres Kennenlernexemplar € 4,– € / SFr. 6,– (jeweils inkl. Versandkosten; Bestellung im W+W Shop: https://www.wort-und-wissen.org/produkt-kategorie/sij/)
Fachtagungen
Fachtagung Philosophie
17. – 19. Januar
Ort: Diakonissen-Mutterhaus Lachen, 67435 Neustadt, Flugplatzstr. 91-99
Referenten und Themen:
- Dr. Thomas Jahn: Muss KI verkörpert sein, um intelligent zu sein?
- Dr. Peter Korevaar: Künstliche Intelligenz – Wirkungsweise und Anwendungsbeispiele
- Prof. Dr. Uwe Meixner: Die Eigenrealität des Bewusstseins und der Bewusstseinsintelligenz
- Dr. Susanne Roßkopf: Hintergründe zur kritischen Theorie/Frankfurter Schule
- Prof. Dr. Daniel von Wachter: Schlechte Philosophie – Arten von Philosophie, die von der Wahrheitssuche abhalten
- Dr. Markus Widenmeyer: Was den Menschen von KI unterscheidet
Anmeldung und weitere Informationen
Fachtagung Biologie
28. – 30. März
Ort: Freizeitheim Friolzheim, Mühlweg 8, 71292 Friolzheim
Referenten und Themen u. a.:
- Dr. Peter Borger: Variation inducing genetic elements
- Prof. Dr. Nigel Crompton: Mendelian Speciation Model
- Dr. Robert Carter: The Braided Baramin Concept
Anmeldung und weitere Informationen
Tagung für Pädagogen und Interessierte
28. Februar – 03. März
Ort: Diakonissen-Mutterhaus Lachen, 67435 Neustadt, Flugplatzstr. 91-99
Referenten und Themen:
- Dr. Reinhard Junker: Die grundlegenden Erkenntnisse der Fossilienforschung für Evolutionsbiologie und Schöpfungswissenschaft – Teile I & II
- Dr. Susanne Roßkopf:
1. Transformation der Gesellschaft – eine Erfolgsgeschichte der Linken
2. Gendermainstreaming von den 1920ern bis heute - Dr. Peter Borger:
1. Was sind Viren und wie passen sie in Gottes gute Schöpfung?
2. Evolutionsmechanismen – wo Darwin grundlegend falsch lag - Dr. Joachim Cochlovius:
1. Orchideen – Kleinode der Schöpfung
2. Superleistungen und frappierende Schönheit in der Vogelwelt
Predigt: Von Vögeln, Blumen und Sorgen (Pastor J. Cochlovius)
Mit Workshops zu verschiedenen Themen am Samstag und Sonntag.
Infos und Anmeldung